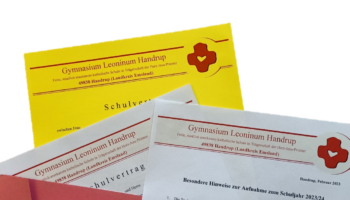Der Weg ist das Ziel – Als Pilger nach Santiago de Compostela
Andrea Schwarz
Schriftstellerin
Vortrag im Rahmen des „7. Handruper Forums“ vom 10. März 1999.
(Zu diesem Abend existieren nur mehr Manuskripttexte und Transkriptionen von Bandmitschnitten.)
Begrüßung durch P. Dr. H. Wilmer SCJ, Schulleiter
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Schwestern, liebe Mitbrüder, meine sehr geehrten Damen und Herren!
Sie alle begrüße ich sehr herzlich hier zum Handruper Forum, heute abend speziell zum 6. Handruper Forum, das unter dem Thema steht: “Die Sehnsucht ist größer”. Von der Pilgerschaft nach Santiago de Compostela.
Wir sind froh und stolz darauf, die Schriftstellerin Frau Andrea Schwarz für dieses Forum gewonnen zu haben. Frau Schwarz, wie einige vielleicht wissen, stammt aus Wiesbaden, wohnt derzeit in Wahlheim, und das liegt zwischen Mainz und Mannheim. Im Internet befinden sich mittlerweile 19 Bücher, die sie veröffentlicht hat, Titel im Herder Verlag, einige sind Ihnen sicherlich bekannt, ich möchte nur mal einige nennen:
•Ich mag Gänseblümchen – Unaufdringliche Gedanken
•Bunter Faden Zärtlichkeit
•Der kleine Drache “Hab’ mich lieb”, ein Märchen für große Leute
•Und alles lassen, weil er mich nicht lässt, Lebenskultur aus dem Evangelium, dieses Buch hat sie herausgegeben zusammen mit dem Benediktinermönch Anselm Grün, ein anderes Buch lautet:
•Wenn Chaos Ordnung ist, und dann ist im vergangenen Jahr herausgekommen:
•”Die Sehnsucht ist größer”, vom Weg nach Santiago de Compostela
Frau Schwarz ist diesen Weg 1997 zu Fuß gegangen und hat zu Fuß 560 km auf diesem Camino zurückgelegt. Zur Zeit ist ein Buch im Erscheinen begriffen, im Herder – Verlag, es wird Ende März herauskommen, mit dem Titel: Entschieden zur Lebendigkeit.
Wie gesagt, Frau Schwarz stammt aus Süddeutschland, aber sie mag das Emsland, sie hat hier schon
Urlaub gemacht, hat sie mir erzählt, und zwar in Großstavern, schwärmt davon, war drei Wochen dort. Persönlich kenne ich Frau Schwarz schon lange, nämlich seit Frühjahr 1987, kurz vor meiner Priesterweihe hat sie uns Seminaristen im Erzbistum Freiburg Tage gehalten zur Jugendarbeit. Sie war damals die Leiterin des Bundes der Katholischen Jugend im Bistum Freiburg und kam zusammen mit dem Pfarrer Irslinger ins Seminar mit dem Ziel, uns Kniffe, Techniken und Methoden an die Hand zu geben für die freie Jugendarbeit. Seither kennen wir uns sehr gut und sind gut befreundet, um so mehr freue ich mich, heute abend Frau Schwarz ganz herzlich hier begrüßen zu dürfen. “Frau Schwarz, herzlich willkommen, hier im Gymnasium Leoninum.”
Ich freue mich auf den Vortrag, auf die Erfahrungen, und Ihnen allen wünsche ich einen angenehmen und bereichernden Abend!
Dankeschön!
Vortrag Andrea Schwarz
Ja, schönen guten Abend auch meinerseits. Ich weiß zwar nicht, warum ein solches Schmunzeln durch den Raum ging, wenn man sagt, man macht drei Wochen Urlaub in Großstavern? Es ist ausgesprochen schön dort, und im Umkreis von 50-80 km kann man ganz schöne Sachen entdecken. Also, ich erinnere mich sehr sehr gern an den Urlaub zurück, und seit der Zeit bin ich dem Emsland verbunden, hab’ sogar meinen 40. Geburtstag in Haselünne gefeiert. Ja, also soweit erst einmal meine Liebeserklärung zum Emsland.

Andrea Schwarz
Ich sag’ nun mal ein bisschen was zu mir: Andrea Schwarz, ich bin 43 Jahre alt. Ich sag’s wegen der Haarfarbe dazu, die irritiert gelegentlich etwas. – Mir ist es bei einem Vortrag vor einiger Zeit passiert, dass ein Mann anschließend auf mich zukam und gesagt hat, es wäre ja sicherlich alles ganz interessant gewesen, was ich gesagt hätte, aber er hätte den ganzen Abend darüber nachdenken müssen, wie alt ich eigentlich sei, dass er gar nicht hätte zuhören können. Und seit der Zeit habe ich mir angewöhnt, das gleich vorneweg zu sagen, weil dann braucht man da nimmer drüber nachdenken. Ich bin in Wiesbaden geboren und aufgewachsen, Industriekaufmann gelernt, – zu meiner Zeit wirklich noch Kaufmann, die Zeiten sind noch gar nicht so lange her. Bin in der Zeit in die katholische Jugendarbeit reingeraten, damals in die KJG (Katholische Junge Gemeinde), war 4 Jahre lang ehrenamtliche Diözesanleiterin der KJG in der Diözese Limburg, hab’ in der Zeit gemerkt, dass das mit der Industrie doch nicht so das Wahre für mich ist, habe gewechselt und Sozialpädagogik studiert in Frankfurt, bin dann ins Badische gegangen als Dekanatsjugendreferentin, BDJK-Diözesanleiterin, hab’ da P. Wilmer unter anderem auch kennengelernt und bin seit 1988 freiberuflich tätig, mit so drei Standbeinen. Das eine ist die Aus- und Weiterbildung haupt- und ehrenamtlicher kirchlicher Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, da komm’ ich gerade her, hab’ gerade eineinhalb Tage die Tagung der Krankenhausseelsorger und -seelsorgerinnen der Diözesen Osnabrück und Hamburg im LWH in Lingen geleitet und fahr’ morgen nach Georgsmarienhütte ins Haus Ohrbeck, ein offenes Tagesseminar. Das zweite Standbein ist die Beratungstätigkeit in Supervision und als Organisationsberaterin. Das dritte Standbein ist die Schriftstellerei. In Arbeit ist derzeit ein Buch, auf das ich mich selbst sehr freue, denn das schreib’ ich mit meinem Pfarrer zusammen, mit dem schönen Titel: “Mit Handy, Jeans und Stundenbuch”. Bei dem Titel haben wir gedacht, es muss für jeden ein Begriff dabei sein, mit dem er nicht ganz soviel anfangen kann. Das funktioniert auch ganz gut. – Kürzlich habe ich mit Pastoralreferenten gearbeitet und dann sagt eine: “Wie war der Titel? Mit Handy, Jeans und was?” Auch gedacht, na ja, gut! Seit Herbst ’97 studiere ich Theologie, in Frankfurt, St. Georgen, letztes Jahr habe ich gerade 8 Wochen Crashkurs Latein hinter mich gebracht, es scheint irgendwie immer um alternative Urlaubsgestaltung im Moment zu gehen, und das aller aller Neueste, worüber ich mich sehr freue, ich hab’ mit einem Freund, der Priester ist, zusammen am 01. 02. mit einer halben Stelle in zwei Pfarrgemeinden in Viernheim angefangen. Viernheim ist der äußerste Südzipfel der Diözese Mainz und liegt östlich von Mannheim, und mir tut es sehr gut, nach diesen Jahren des Unterwegsseins von Osnabrück bis St. Gallen, mich jetzt in zwei Gemeinden, viertgrößte Seelsorgeeinheit der Diözese Mainz, als pastorale Mitarbeiterin, zu verorten, um dort Heimat zu bekommen. Ja, soweit mal zu mir.
Zum heutigen Abend: der wird in zwei Teilen ablaufen. Ich möchte gern im ersten Teil zehn Sprachbilder aufzeigen von meinem Weg nach Santiago de Compostela, zehn Sprachbilder, zehn Erfahrungsbilder, die übertragbar sind in Ihren ganz persönlichen Alltag. Was ich nicht möchte, ist ein langweiliger Vortrag, im Sinne von: am dritten Tag hab’ ich da übernachtet, und am fünften Tag waren es da 28 km. Das vergisst man sowieso, das interessiert auch keinen Menschen. Aber was für Erfahrungen macht man denn auf einem solchen Weg?
Und im zweiten Teil möchte ich ein paar ausgewählte Dias zeigen, um einfach auch einen Eindruck zu vermitteln, wie ist es denn da, wenn man unterwegs ist.
So, vielleicht noch ein bisschen was vorne weg zum Thema “Pilgern”. Pilgern ist ein Wort, was ein bisschen als Wort aus der Mode gekommen ist. Aber ich glaube, dass das eigentlich nur das Wort ist, was nicht mehr so oft benutzt wird. Die Menschen pilgern wie eh und je, nur die Pilgerziele haben sich verändert. Menschen brechen auf, machen sich auf die Suche nach dem Sinn ihres Lebens oder nach dem, was sie meinen, was Sinn ihres Lebens sein könnte. Für die einen mag es die Urlaubswochen im Süden sein, in die nach sinnentleerten Arbeitswochen alles mögliche hineinprojeziert wird, für andere ist es Beziehung oder Ehe. Für andere mag es die Fahrt nach Hamburg zum Musical sein, die auch eine Art moderner Pilgerfahrt darstellt oder der Urlaub an der Türkischen Küste. Immer wieder aber hat Pilgern etwas mit Unterwegssein zu tun, mit aufbrechen, sich auf den Weg machen. Aus meiner Sicht hat ein solches sich auf den Weg machen auch immer etwas mit Gott zu tun, mit der Sehnsucht nach einem Sinn, der unsere Wirklichkeit übersteigt, auch wenn es immer wieder manche geben mag, die das für sich so nicht akzeptieren und nicht annehmen wollen. Diese Sehnsucht hat dazu geführt, dass immer wieder Pilgerwege entstanden sind. Pilgerwege, die von vielen Menschen gegangen wurden, weil die Erfahrung gezeigt hat, dass man auf diesem Weg etwas erleben kann, dass man auf diesem Weg Antworten auf die Frage nach dem Sinn des Lebens bekommen kann. Da gab es einen Ort, ein Ziel, einen Namen, dem ein besonderer Ruf vorauseilte, der die Hoffnung weckte, der der Sehnsucht Raum gab. Und Menschen sind über Jahrhunderte hinweg diesem Ruf gefolgt, haben der Sehnsucht getraut und sind aufgebrochen. Ein Weg wird dann zum Weg, wenn die Menschen ihn gehen, ein unbegangener Weg verwuchert und gerät in Vergessenheit. Es gibt Wege, die Jahrhunderte und Jahrtausende alt sind, und wenn sie sich nicht irgendwie bewährt hätten, wären sie in Vergessenheit geraten, und dann gäbe es sie nicht mehr. Es gibt Orte und Wege, die alle Zeitströmungen überdauern und gerade dadurch zeigen, dass es eben nicht egal ist, wohin man geht und wo man sich aufhält.
Es gibt Wege, die eine Kraft in sich bergen, die sich unserem verstandesmäßigen Denken entzieht. Und so mag es auch nicht von ungefähr kommen, dass sich an solchen Wegen, an solchen Orten der Kraft immer auch wieder christliche Kirchen und Klöster angesiedelt haben, wo schon vorchristliche Kulturen solche Kräfte erspürt und verehrt haben.
Der Weg nach Santiago de Compostela ist solch ein Weg. Und es gibt Forscher, die sagen, dass der heutige Camino, wie er liebevoll in Spanien genannt wird, eigentlich ein vorchristlicher Initiationsweg ist, der bereits vor dem Christentum von Menschen gegangen wurde, und der später dann vom Christentum übernommen wurde.
Santiago der Compostela, im Nordwesten Spaniens gelegen, einer der drei berühmtesten Wallfahrts-orte des Mittelalters neben Jerusalem und Rom. Dort soll das legendäre Grab des Apostels Jakobus sein, und ich glaube, dass die Attraktivität dieses Ortes mit daher rührte, dass, wenn man zu Santiago noch 70 km dazu gelegt hat, und das war keine große Strecke mehr, wenn man möglicherweise schon von Aachen unterwegs war, dann war man am Finesterre, dort, wo man damals meinte, dass die Welt aufhört. In den letzten Jahren hat gerade der Weg nach Santiago de Compostela einen neuen Aufschwung bekommen. In diesem Jahr geht z.B. die Landvolkbewegung der Erzdiözese Freiburg mit 400 Leuten nach Santiago, macht ein großes Verbandsereignis aus diesem Weg. Und dieser Weg startet eigentlich von der eigenen Haustür. Im Mittelalter ging man von Zuhause los. Und je näher man dann sich Santiago näherte, um so mehr verdichteten sich die Wege, einfach weil es keine Alternativen mehr gab. Es schälten sich vier große Pilgerwege heraus, die über Vézelay, über Einsiedeln gingen, das Rheintal hinunter gingen, und vor den Pyrenäen verbinden sich drei dieser Wege. In Puente la Reina kommt der vierte Hauptpilgerweg dann dazu.
Ab Puente la Reina wird der Weg dann nur noch “El Camino” genannt – liebevoll: “Der Weg”. Und wenn man in Spanien von “El Camino” spricht, weiß jeder genau, was gemeint ist. Im Mittelalter ging man diesen Weg auch wieder zurück. Wenn man dort angekommen war, lag der Heimweg wieder vor einem, der geht heute in der Regel etwas rascher über Flugzeug, oder Eisenbahn, oder Bus. Ich denke, es war eine interessante Erfahrung, nach dem Ankommen am Ziel dann noch den Heimweg wieder unter die Füße zu nehmen. Ab St.-Jean Pied- de- Port, dem letzten Ort in Frankreich, sind es bis Santiago noch 760 km. Man kann diesen Weg zu Fuß gehen, mit dem Fahrrad machen, manche machen ihn mit dem Pferd, es gibt Alternativen mit dem Bus und zu Fuß, manche fliegen auch einfach hin. Aber jeder dieser Wege macht auch etwas mit den Menschen, die dort hingehen, dort hinfahren, dort hinlaufen.
Ich bin 1997 Ende Mai losgegangen, sechs Wochen, davon vier Wochen alleine, ab Leon kam eine Freundin dazu. 560 km unter die Füße, unter die Wanderschuhe genommen, einige statistische Zahlen: Ich hab’ in der Zeit 10 kg abgenommen, 5 Tuben Mobilat verbraucht und sechs Tuben Fußcreme. Seit den Wochen schwöre ich auf Fußcreme. Ich habe immer gedacht, das wäre was für ältliche Damen. Aber ich kann sagen, ich bin ohne Blase die 560 km durchgekommen – ein Tip der Fußpflegerin, die ich vorher noch mal aufgesucht hab’. Und alle, die jemals auf die Idee kommen sollten, diesen Weg zu Fuß unter die Füße zu nehmen, ich kann nur den ganz heißen Tip geben, Fußcreme ist eine der notwendigsten Sachen, die man wirklich mit auf diesen Weg nehmen sollte.
Es waren sicherlich sechs sehr intensive Wochen meines Lebens, wenn nicht sogar die intensivsten. Ich merke, dass ich heute fast zwei Jahre später noch immer an den Erfahrungen dran bin, die dieser Weg mir geschenkt hat und was dieser Weg auch mit mir gemacht hat. Erfahrungen des Weges: träumen, loslassen, aufbrechen, unterwegs sein, ankommen. Und es sind Wegerfahrungen, die durchaus auf das wirkliche Leben übertragbar sind. An diesen Wegerfahrungen möchte ich Sie heute abend ein wenig teilhaben lassen. Vielleicht kann noch ein Satz von Nietzsche, dem großen deutschen Philosophen zu Beginn stehen. Die Empfehlung von Nietzsche heißt:
So wenig als möglich sitzen, keinem Gedanken Glauben schenken, der nicht im Freien geboren ist und bei freier Bewegung, indem nicht auch die Muskeln ein Fest feiern.
Und religiös beendet er seine Überlegung und sagt: “Das Sitzfleisch ist die eigentliche Sünde wider den Hl. Geist.”. Ich glaube, dass Christsein immer die Einladung zum Aufbrechen, zum Unterwegs sein ist. Noch eine kleine Geschichte vorneweg, aber dann steige ich wirklich ein.
Richard Rohr, ein amerikanischer Franziskaner, sagt so schön: “Wenn man lange genug bei Gott ‘rumhängt’, färbt der Typ auch irgendwie ab.” Das ist eine Erfahrung, die ich gut nachvollziehen kann.
Meine Eltern sind jetzt über 50 Jahre verheiratet. Als ich so klein war hat der Vater den Kaffee schwarz und mit Zucker getrunken und die Mutter ohne Zucker, aber mit Milch. Inzwischen nehmen beide ein bisschen Milch und ein bisschen Zucker. Ich bin drei Tage in Österreich und brauche ein Vierteljahr, um mir das “Auf Wiederschauen” wieder abzugewöhnen. Oder, kürzlich bei einem Kurs kam abends ein junger Mann kichernd vom Telefon zurück und ich sage: “Hei, was ist denn mit dir los?” Sagt er: “Ich hab’ grad’ telefoniert, mit ‘nem Freund, hab’ ihm von diesem Kurs erzählt und zwischendrin unterbricht der mich und sagt: ‚Machst du grad’ ‘nen Kurs bei der Andrea Schwarz?’ Ich sagte warum, wie kommst du denn da drauf? ‚Ja’, sagte er, ‚weil du dauernd das Wort ‘Lust’ gebrauchst.” Wie doch die Sprache abfärben kann. Oder das verblüffendste Beispiel von Abfärben finde ich immer die oft erstaunliche Ähnlichkeit zwischen Hund und Hundebesitzer. Und, wenn das überhaupt nicht übereinstimmt, lohnt es sich, die Frage zu stellen, ob es möglicherweise ein Gast- oder ein Leihhund ist. Aber in der Regel ist es wirklich oft sehr erstaunlich. Und wenn man lange genug bei Gott rumhängt, dann färbt der Typ auch irgendwie ab. Wenn man bei einem Typ rumhängt, der von sich sagt: “Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben”, dann ist das die Einladung zum Unterwegssein, wenn derjenige abfärbt, der “Weg” ist, wenn derjenige abfärbt, der “Wahrheit” ist, dann ist das die Einladung zur Authentizität, zum “Echtsein”. Und wenn derjenige abfärbt, der “Leben” ist, dann ist das die Garantie für die Lebendigkeit. Und das, glaube ich, will eigentlich unser Glaube und das Christentum: Einladung zur Lebendigkeit sein.
1. Szene:
Ein bisschen ratlos sitze ich in meinem Wohnzimmer. Um mich herum T-Shirts, das kleine Stundenbuch, Socken, Fotoapparat, Tagebuch, Wanderführer, Sonnencremetuben, Metrofahrkarten und vieles andere mehr. Grad’ hab’ ich den Rucksack wieder ausgepackt. 15 kg, das ist eindeutig zuviel. Damit komme ich nie zu Fuß nach Santiago. Und dabei hatte ich doch schon bei der Erstellung der Packliste versucht, mich auf das Allernotwendigste zu beschränken. Aber es hilft alles nichts. Ich muss diesen kunterbunten Stapel noch mal gewichtsmäßig um ein Drittel reduzieren.
Nun werde ich in drei Tagen den Pilgerweg nach Santiago beginnen. Über die Pyrenäen, durch die Meseta, die Hochfläche zwischen Burgos und León. Und das geht nicht, mit 15 kg Gepäck auf dem Rücken. Grübelnd schaue ich mir das Durcheinander im Wohnzimmer an. Was brauch’ ich für 6 Wochen Wanderung? Für mich ist das eine ganz neue Erfahrung. Ich bin zwar oft viel unterwegs, aber mit dem Auto. Da kommt es auf ein Paar Schuhe mehr oder weniger nicht an. Jetzt zählt jedes Gramm. Ganz interessant, ich habe wirklich mit der Küchenwaage dagesessen und hab’ rausgekriegt, dass T-Shirts tatsächlich ganz unterschiedlich viel wiegen. Also es gibt 300 gr. T-Shirts, es gibt 400 gr. T-Shirts. Und wenn man nur 10 kg mitnehmen darf, dann lohnt es sich tatsächlich, diese Unterschiede nochmals ‘rauszukriegen. Oder das kleine Stundenbuch entspricht 2 T-Shirts. Ganz interessante Konstellationen, die sich damit so auftun. Jetzt zählt tatsächlich jedes Gramm. Soll ich die Elastikbinde nicht doch noch daheim lassen? Was mache ich mit den Plastikdosen? Brauch’ ich die eigentlich wirklich? Plötzlich geht mir ein Licht auf. Bei der Erstellung der Packliste habe ich mich von der Frage leiten lassen, was könnte ich möglicherweise brauchen? Ich hab’ mir alle möglichen Situationen vorgestellt, in die ich unterwegs kommen könnte und wollte mich für alle Fälle absichern. Und so tauchte plötzlich die Salbe gegen Zerrungen auf der Liste auf, und das Blasenpflaster, und das vierte T-Shirt, und der Notizblock, und, und, und… . Die richtige Frage aber müßte eigentlich heißen: Was brauch’ ich jetzt wirklich? Und will ich wirklich ernsthaft eine Elastikbinde sechs Wochen quer durch Nordspanien mittragen, und sie im Endeffekt gar nicht brauchen?
Mit dieser neuen Frage lässt der Stapel sich plötzlich noch mal ganz neu sortieren. Und als die Waage dann 11 kg anzeigt bin ich zwar noch nicht ganz zufrieden, aber kann mir zumindest mal vorstellen, mich damit auf den Weg zu machen. Kleiner Hinweis, man kann in Nordspanien übrigens alles kaufen, es ein durchaus sehr kultiviertes Land. Sie brauchen nicht daran denken, alles mögliche mitzunehmen, es gibt Apotheken, alles vorhanden, also von daher gehen Sie ruhig, falls Sie eines Tages mal losgehen, mit wenig Gepäck los. Was notwendig ist und was sich unterwegs als notwendig erweist, kriegt man dort. Aber ich bin ein bisschen nachdenklich geworden. Könnte es sein, dass ich auch in meinem Alltagsleben manchmal zuviel Gepäck mitschleppe? Weil ich meine, mich für alle Eventualitäten absichern zu müssen? Könnte es sein, dass die Frage, was könnte ich möglicherweise brauchen, dazu führt, dass sich Dinge um mich herum so anhäufen, dass deren Gewicht mich fast erdrückt? Könnte es sein, dass das, was mich absichern will, mich zugleich in meiner Bewegungsfreiheit einschränkt? Dass ich vor lauter Nachdenken über den möglichen Fall des Falles gar nicht mehr zum Loslaufen komme? Die Frage, was brauche ich jetzt wirklich, statt, was könnte ich evtl. brauchen, könnte mir vielleicht auch in meinem Leben helfen, die Dinge neu zu sortieren und Schwerpunkte zu setzen.
Der Weg hat mir seine erste Lektion schon erteilt, noch bevor ich los gelaufen bin.
2. Szene:
Mitternacht in St.-Jean-Pied-de-Port. Die Kirchturmuhr schlägt. Ich hab’ mir den Pullover übergezogen und sitze mit meinem Pilgertagebuch auf der Steinbank vor dem Refugio, der kleinen Herberge in St. Jean. Aus dem Schlafsaal kommt ein herzhaftes Schnarchen. An Schlaf ist überhaupt nicht zu denken. Zum Glück ist direkt neben der Bank eine Straßenlaterne, so dass ich genug Licht zum Schreiben habe. Es war ein sehr spannender Abend für mich, dadurch, dass ich in der Regel bei Seminaren in der Leitung bin, habe ich in den letzten Jahren immer nur Einzelzimmer gehabt, und ich hab’ gar nicht mehr gewußt, wie laut es sein kann, mit anderen Menschen zusammen in einem Zimmer zu schlafen. Und an dem Abend habe ich wirklich ein faszinierendes Schnarchduett erlebt, wir waren zwar nur zu fünft, aber zwei davon waren überzeugte Schnarcher, die sich erstens abgewechselt haben und dann wirklich mal eine viertel Stunde im Duett geschnarcht haben, der eine von unten links schnarchend gerufen: “Ur!” Von oben rechts kam dann immer die entsprechende Antwort: “Ar!”
Das waren ganz nette Menschen, ich konnte ihnen nicht bös’ sein, aber an schlafen war wirklich nicht zu denken. An dem Abend habe ich die These aufgestellt, dass wahrscheinlich der Ohropax-Verbrauch entlang des Caminos erheblich höher ist als sonst im Durchschnitt Spaniens. Aber es sind nette Menschen, die auf dem Weg sind, aber wie gesagt, manchmal ein bisschen laut nachts.
Ja, jetzt bin ich also auf dem Weg nach Santiago. Fast kann ich es selbst noch nicht glauben. Ich weiß gar nicht, wodurch sich dieser Traum eines Tages in mein Herz eingenistet hat. Aber, kann man das von Träumen so genau sagen? Santiago wurde zur Chiffre für: Irgendwann mache ich das mal.
Vor zwei Jahren aber wurde aus dem Traum plötzlich ein konkretes Vorhaben. Ich war 40 Jahre alt geworden, wie gesagt in Haselünne, hatte mich entschieden, noch einmal zu studieren, eine neue Lebensphase zeichnete sich ab. Ein Übergang war angesagt. Und plötzlich war mir klar, wenn der Weg nach Santiago überhaupt in meinem Leben einen Sinn, einen Ort hat, dann zu diesem Zeitpunkt.
Ich hab’ im Kalender seitdem sieben Wochen freigehalten, erfolgreich gegen alle Terminanfragen verteidigt, las mich in die entsprechende Literatur ein, erkundigte mich bei anderen, die den Weg schon gegangen waren, kaufte Schlafsack und Rucksack und lief im Schwarzwald schon mal probe. Auch Träume wollen vorbereitet und organisiert sein. Aber trotz aller Vorbereitungen, es war irgendwie immer noch unwirklich. Und jetzt sitz ich also hier in St-Jean vor dem Refugio und komme zum ersten Mal nach der Zeit des Packens und des Vorbereitens ein bisschen zur Besinnung. Ja, ich bin hier, und morgen geht es in die Pyrenäen. Ich bin auf dem Weg. Fast kann ich es selbst noch nicht glauben. Und ganz ehrlich gesagt, ich hab’ auch ein bisschen Angst. Manchmal kann man schon ein wenig erschrecken, wenn Träume plötzlich wahr werden., Wünsche sich erfüllen. Plötzlich wird es konkret, und vielleicht wird es ganz anders als ich es mir erträumt habe? Vielleicht bleibt die Wirklichkeit hinter meinem Traum zurück, und ich bin nur enttäuscht. Und selbst, wenn sich alles so erfüllt, wie ich es mir erträumt habe, werde ich anschließend doch einen Traum weniger haben. Manchmal ist es gar nicht so einfach, wenn Träume wahr werden. Und mir fällt in diesem Moment der Satz eines Freundes ein. “Sei vorsichtig mit dem, was du dir wünscht und warum du betest. Es könnte in Erfüllung gehen.” Man sollte auch vorsichtig sein, um Leben in Fülle zu leben. Man könnte es kriegen, anschließend. Das ist was wirklich Großes, was ich mir vorgenommen habe, und ich zweifle ein wenig an mir selbst. Siebenhundertachtzig Kilometer zu Fuß, wie soll das denn gehen?
Das schaff’ ich doch nie! Aber da kommt mir plötzlich Beppo, der Straßenkehrer aus der schönen Geschichte von Michael Ende, “Momo”, in den Sinn. Er hat eine unübersehbar lange Straße vor sich, die er fegen soll und fast lähmt ihn das. Wenn ich mir die siebenhundertachtzig Kilometer vor Augen halte, dann trau’ ich mich gar nicht erst loszugehen, so groß ist das Projekt. Beppo schaut aber immer nur auf das Nächste, was zu tun ist. Also: Schritt, Atemzug, Besenstrich. Das aber beharrlich. Das hieße für mich, meine Schritte zwar auf Santiago ausrichten, aber für morgen nur Roncesvalles, den Zielort meiner ersten Etappe, in den Blick nehmen. Mich tröstet dieser Gedanke ein wenig, und er macht mir auch Mut, mich von der Größe einer Aufgabe oder Herausforderung nicht lähmen zu lassen, sondern das Ziel vor Augen, beharrlich Schritt für Schritt gehen. Ich glaube auch, ohne diese Caminoerfahrung würde ich jetzt auch nicht mit dieser Beharrlichkeit Theologie studieren. Das Ende ist nicht absehbar. Aber Schritt für Schritt, Schein für Schein, wenn man beharrlich genug ist, wird man eines Tages vielleicht auch das Diplom haben.
Ich spitze die Ohren Richtung Refugio. Tatsächlich, es ist ruhig geworden. Das ist die Chance, wohlig müde kuschele ich mich in meinen Schlafsack, und kurz vor dem Einschlafen denke ich nochmal, ich bin auf dem Weg. Schritt, Atemzug, Besenstrich, und ich freu’ mich d’rauf.
3. Szene:
Der Finger des Arztes zeigt ziemlich unbarmherzig auf die Zeile in dem viersprachigen Patientenführer: “Diesen Verband dürfen Sie nicht abnehmen!” Bei diesem Verband handelt es sich um eine dicke Elastikbinde um mein Knie, die das Gehen schlichtweg unmöglich macht. An ein Weitergehen ist überhaupt nicht zu denken. Den Traum Santiago de Compostela kann ich mir erst mal abschminken. Es hilft nichts. Draußen vor dem Gesundheitszentrum steigen mir doch die Tränen hoch. Da hatte ich so lange geplant und mich vorbereitet und jetzt das. Der Abstieg von den Pyrenäen hatte wohl die Bänder in einem Kniegelenk überanstrengt. Auf ebener Strecke ging es ja noch mit dem Gehen, aber jeder Auf- und Abstieg tat höllisch weh. So war mir also nichts anderes übrig geblieben, als in Pamplona den Arzt aufzusuchen, und der hatte mir jetzt also die Rote Karte gezeigt. Aus der Traum. In der Beziehung hatten es die Pilger im Mittelalter einfacher. Die konnten einfach eine Woche lang irgendwo bleiben und ihre Verletzung auskurieren. Wenn ich eine Woche nicht gehen darf, dann ist klar, ich kann nicht die gesamte Strecke nach Santiago zu Fuß machen. Die Zeit sitzt mir im Nacken, die Verpflichtungen zu Hause. Mit meinem lädierten Knie ziehe ich nach Puente la Reina um. Pamplona ist mir zu laut, und in Puente habe ich jetzt viel Zeit zum Nachdenken.
Ich hadere ein bisschen mit meinem Schicksal, aber es hilft ja alles nichts. So ist es nun einmal. Ein erster Gedanke, der mir in diesen Tagen kommt: Der Körper holt sich das, was er braucht. Ich bin aus dem absoluten Stress aufgebrochen, habe sogar vorher schon zwei Kilogramm abgenommen. Der Körper braucht Ruhe, die Seele will nachkommen, und beides ist in diesen erzwungenen Tagen der Ruhe möglich. Ich schlafe und schreibe viel, und ich spüre, dass ich mich auf einmal ganz neu öffnen kann für das, was dieser Weg mir sein will. Ob das so möglich gewesen wäre, wenn ich einfach hätte durchlaufen können? In diesen Tagen wird mir aber noch einmal etwas ganz anderes wichtig. In meiner Tätigkeit habe ich es oft mit Menschen zu tun, die verletzt oder verwundet sind. Wie aber kann ich mich mit ihnen auf einen Weg hin zur Heilung machen, wenn ich selbst nicht weiß, was Gebrochenheit heißt, was Verletzung bedeuten kann. Ich erlebe im wahrsten Sinne des Wortes hautnah, was es heißt, gelähmt zu sein, nicht gehen zu können, in der Bewegung und im Wollen eingeschränkt zu sein. Helfer, die nicht um ihre eigenen Verwundungen wissen, können nicht heilen. Sie können von oben herab Ratschläge erteilen, aber das hilft nicht. Verwundete brauchen Menschen, die mit ihnen gehen, die an ihren eigenen Verwundungen leiden, die wissen, wie sich das anfühlt, wenn es weh tut.
Ich glaube, dass diese Woche mit der Verletzung die Woche war, die mich ganz neu aufgeschlossen hat für die Erfahrungen, die mir der Weg schenken wollte. Und es kann gut sein, dass ich in dieser Woche lernen sollte, dass es zwar ein Ziel gibt, aber man durchaus unterschiedliche Wege dorthin gehen kann. Die Umstände verschwören sich gegen mich, und es klappt nicht, ich komme an eigene Grenzen. Es könnte wichtig sein, dann auch im Alltag das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, aber gegebenenfalls einen anderen Weg zu gehen. Unterwegs bleiben, auf das Ziel hin ausgerichtet – die Frage nach dem konkreten Weg ist dann erst die zweite Frage. Es war eine wichtige Woche für mich, eine Woche in der ich mich mit dem Überlandbus Burgos annähere. Und ich glaube, dass ohne diese Woche, ohne diese Verletzung der Weg anders gelaufen wäre.
4. Szene:
In Burgos mache ich mich langsam und behutsam wieder zu Fuß auf den Weg. Und es tut mir gut. Ich bin anders auf dem Weg. Nichts ist mehr selbstverständlich. Ich bin dankbar für das, was möglich wird. Und nach den Tagen des Alleinseins und des Auf-mich-Gewiesenseins, weil man dann auch aus der Pilgergemeinschaft irgendwie ‘rausfällt, freue ich mich neu an den Weggefährten, an den Mitpilgern und Mitpilgerinnnen, die unterwegs sind. Es gibt nette Kombinationen, nette Weggeschichten. Man unterhält sich fünf Minuten lang mit einem anderen auf englisch, um dann festzustellen, dass wir beide aus Deutschland kommen. Der Camino insgesamt ist viersprachig: Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch. Ein wildes “Gedolmetsche”, ich hab’ in den Wochen meine Sprachenkenntnisse wieder aufgefrischt und ausgesprochen viel gelernt, was die Flexibilität bei den Sprachen angeht.
Ich hab’ unterwegs Menschen aus siebzehn Nationen getroffen, von Brasilien bis Finnland, und zu meiner eigenen Überraschung, viel Ältere. Zu der Jahreszeit, wo ich unterwegs war, vor allen im Juni, sind wenig Jüngere unterwegs, sondern viele Anfang sechzig Jahre, die die Zeit der Pensionierung nutzen und sagen, jetzt habe ich endlich Zeit und Raum, diesen Weg zu gehen. Ich gehörte eher zum jüngeren Durchschnitt, der unterwegs war. Die Beziehung zwischen den Menschen auf dem Weg gestalten sich interessant, es gibt den Caminotelegraph, wie man so schön auf dem Camino sagt, man weiß, wer vor einem ist, wer schneller geht und gibt denen, die schneller laufen, Grüße an diejenigen mit. Denjenigen, die hinter einem sind, weil sie durch eine Verletzung pausieren mußten, hinterlässt man Grüße in Gästebüchern, man erzählt sich in den Refugios abends die Geschichten: “Hast du auch die verrückte französische Malerin gesehen, die mit Staffelei und 20 Kilogramm Gepäck die Pyrenäen überquert hat?” Oder: “Habt ihr schon den französischen Pilger mit dem Hund getroffen, der unterwegs ist?” Und eine der schönsten Geschichten gab’s von Maria und Piet. Maria, eine Amerikanerin, die sich ein Vierteljahr Sabbatzeit genommen hat, Piet ein Holländer, der in Holland losgelaufen ist. Unterwegs trafen sich die beiden, fanden irgendwie Gefallen aneinander, sind drei Tage miteinander gegangen. Dann fiel ihnen irgendwann wieder ein, dass sie ja eigentlich alleine gehen wollten. So trennten sie sich. Maria blieb ein Tag an dem Ort, Piet ging die nächste normale Tagesetappe. Am Abend haben sie dann gemerkt, eigentlich stimmt das jetzt auch nicht, ganz unabhängig voneinander. Daraufhin blieb Piet an dem Ort und pausierte, und Maria machte die doppelte Tagesetappe, um Piet wieder einzuholen. Und damit trafen sich die beiden wieder und sind den Rest des Weges zusammen nach Santiago gelaufen. Piet ist übrigens von Santiago auch wieder nach Holland zurückgelaufen. Er war ein und ein halbes Jahr unterwegs.
Die Solidarität der Gefährten auf dem Weg ist wichtig. Ich bin nicht allein, da sind andere, die mit mir gehen. Andere, die ich aber auch wieder ihren Weg gehen lassen muss. Unterwegs ist man, selbst wenn man in einer Gruppe ist, auch immer für sich.
Ich kann andere Menschen nicht festhalten. Am Abend kann es ein sehr schönes Fest sein mit der Gruppe, die sich im Refugio trifft, am nächsten Morgen verabschiedet man sich und weiß nicht, ob man sich am nächsten Abend im nächsten Refugio wiedertreffen wird. Kann sein, dass es einen rauskickt aus dem Weg, kann sein, dass die anderen ein Refugio weitergehen. Und ich glaube, dass dies auch eine ganze Menge mit Christsein im Alltag zu tun hat. Auch dort brauche ich die Gefährten, brauche ich die Gemeinschaft, mit denen ich unterwegs bin, die mich stärken in meinem Unterwegssein, die mir aber auch das ganz eigene Gehen nicht abnehmen können. Es sind Menschen, von denen ich manchmal weiß, die ich aber nicht unbedingt tagtäglich wiedertreffe. Aber das Wissen um solche Menschen tut mir gut. Weggefährten im Glauben.
5. Szene:
Carrion de los Condes. Ein bisschen skeptisch habe ich schon wohl geschaut, als ich am Morgen die deutsche Übersetzung nachlas, des Tagesevangeliumes. “Nehmt nichts mit auf dem Weg, keine Vorratstasche, kein zweites Hemd, kein Wanderstab. Steckt kein Gold und keine Kupfermünzen in eure Gürtel.” Das Evangelium von der Aussendung der Jünger. Und prompt an dem Tag war mein Rucksack sicher vierzehn Kilogramm schwer. Vor mir liegen 18 Kilometer Einsamkeit. Eine Strecke durch die Meseta ohne Haus, ohne Dorf, ohne Baum. Und je nach Wetter braucht man für solche Strecken dann schon zwei Liter Wasser. Dazu den Proviant für tagsüber und abends. Das macht den Rucksack schwer. Und dann ein solches Evangelium.
Die Strecke durch die Meseta war eine sehr schöne Strecke, für mich eigentlich eine der schönsten Wegetappen. Da bin ich ein bisschen dem Bild von Siegfried Köder aufgesessen, was vielleicht manche von Ihnen kennen, die Meseta als eine braune Ebene. Das mag sein, wenn man im August oder September durch die Meseta geht. Im Mai und im Juni läuft man durch endlos weite wogende Getreidefelder, mit rotem Klatschmohn zwischendrin, man verliert sich in Wind und Weite und Unendlichkeit und Wolken. Mai, Juni ist eine wunderschöne Jahreszeit, um den Camino zu gehen, weil um die Zeit alles grün ist und im September eher schon ins bräunliche Abgeerntete hinübergeht.
Ich hab’ mich an dem Tag in Wind und Weite verloren, bin alleine auf alten Römerstraßen unterwegs, gehe durch diese endlos grünen Getreidefelder, in denen der Wind spielt, selten ein Haus, ein Baum schon über Kilometer hinweg zu sehen, nur Wind, Weite und Wolken. Und ich lass mich hineinziehen in diese Weite, es geht mich und es weitet mich. Ich ahne darum, das ein solches Gehen, eine solche Weite auch süchtig machen kann. Es ist eine Weite, wie ich sie auch hier oben im Norden erlebe und entdecke, und wo ich merke: ja, wenn man in einer solchen Weite lebt, kann man eigentlich nicht “eng” sein. Im Schwarzwald sagt man: je enger das Tal, desto enger der Kopf. Weil einfach die Perspektive sehr begrenzt ist. Und ich merke, dass mir eine solche Weite, wie hier, einfach gut tut. Sie macht mich wiederum weit. Ich genieße das Alleinsein auf dieser Strecke, jedes Gespräch würde nur ablenken vom Sein, vom sich Verbundenfühlen mit Wind, Wolken und dem Weg. Der Kirchturm der kleinen Friedhofskirche von Calzadilla sehe ich schon lange am Horizont, schließlich bin ich auf der kleinen Anhöhe, von der aus der Weg zweihundert Meter hinunter ins Dorf führt. Ich nehme den Rucksack und setze mich ‘drauf, bin müde, dreckig, verschwitzt, sehne mich nach einer Dusche und bleib’ doch auf dieser Anhöhe, das heutige Ziel greifbar vor Augen. Ich bleibe so eine halbe Stunde sitzen. Ich kann den Wind und die Weite noch nicht verlassen. Ich kann noch nicht ankommen. Das ist eine dichte und intensive halbe Stunde dort oben auf dieser kleinen Anhöhe.
Die Schriftstelle von heute morgen hat mich den Tag über begleitet. “Nehmt nichts mit auf den Weg.” Es ist ja eigentlich schon herb, die Jünger folgen Jesus, weil sie in seiner Nähe sein wollen, weil sie in ihm jemanden ahnen, der ihnen etwas geben kann, dass er ihnen guttut, dass er eine wichtige Lebensbotschaft für sie hat. Und er schickt sie weg, und sie lassen sich wegschicken. Und erschwerend dazu, ohne Absicherung, kein Geld, kein zweites Hemd, keine Vorratstasche. Nackt und bloß, angewiesen auf das, was andere ihnen geben, von dem sie leben können. Und noch nicht mal Erfolg wird prophezeit.
Jesus sagt deutlich, es wird Häuser geben, in denen ihr nicht aufgenommen werdet. Man ist fasziniert von einer Idee, von jemandem – und wird ganz unversehens zum Mitarbeiter. Man will bei jemandem bleiben und wird doch losgeschickt. Nachgehen wird zum Losgehen, und man läßt sich ‘drauf ein, ohne wenn und aber. Aber man riskiert sich, investiert sich für eine Idee, eine Ahnung, eine Sehnsucht.
Ich bin ein bisschen nachdenklich an diesem Abend in der kleinen Pilgerherberge und spüre den Erfahrungen dieses Tages nach, die so unterschiedlich so sein mögen und vielleicht ganz viel miteinander zu tun haben.
6. Szene:
Verdutzt stehe ich vor dem Maschendrahtzaun, der plötzlich quer über den kleinen Wanderpfad läuft und mir den Weg versperrt. Was soll das denn? Ich mache ein paar Schritte nach links, ein paar Schritte nach rechts, aber der Zaun ist offensichtlich neu und vollkommen intakt. Und selbst wenn ich irgendwie über diesen Zaun kommen würde, wüßte ich nicht, wie ich mich dann durch die Großbaustelle kämpfen soll, die vor mir liegt, der Baustelle der neuen nordspanischen Autobahn. Ich fluche ein bisschen vor mich hin. Ich scheine mich eindeutig verlaufen zu haben und das gerade an dem Morgen, wo mir das Gehen so schwer fällt. Im Moment geht aber auch alles schief. Gestern abend war die Pilgerherberge in Sahagún wegen Fiesta geschlossen. Ich verstand nicht genug spanisch, um den Zettel an der Tür lesen zu können, Hotelbetten waren auch keine mehr frei. Und so bin ich in meinem Ärger zum nächsten Refugio weitergelaufen. Für gestern abend hatte ich den Anruf mit einer Freundin vereinbart, die ab Leon dazu kommen will, um miteinander die letzten Sachen zu klären. Nachdem ich in dem kleinen Ort ein öffentliches Telefon gefunden hab’, funktioniert es natürlich nicht. Und das nächste Telefon ist fünf Kilometer entfernt. Und jetzt, am Morgen, wo mir das Gehen so schwer gefallen ist, hab’ ich mich auch noch verlaufen. Es ist genauso wie zu Hause, immer gehen gleich drei Sachen schief, aber es hilft alles nichts, ich muss wieder zurück. Ich hätte in .Calzada del Coto.übernachtet. Von dort aus kann man entweder auf dem alten Pilgerweg, den alten Römerstraßen, weiter nach Santiago gehen, oder man wechselt auf die neue Pilgertrasse. Mit Mitteln der europäischen Gemeinschaft hat man in Spanien neben dem alten Camino eine Art Pilgerautobahn angelegt, direkt neben einem breiten großen Feldweg, alle zehn Meter gesäumt von einer Platane, die um’s Überleben kämpft, strikt geradeaus, entsprechend langweilig. Und die Spanier sind ein bisschen stolz auf diesen neuen Weg. Und deswegen ist der neue Weg markiert und der alte und dessen Markierungen verfallen ein bisschen. Ich wollte an dem Morgen diese Pilgerautobahn vermeiden und hatte mich deshalb für den alten Weg entschieden. Und an irgendeiner Kreuzung muss ich mich wohl entsprechend verlaufen haben, wegen mangelnder Markierung. Im übrigen, der Camino ist hervorragend durchmarkiert, aber jeder verläuft sich irgendwann mal auf dieser Strecke in einem Zustand mentaler Verwirrung. Einem Freund ist es passiert, der tauchte auf einmal in einem Dorf auf und wurde von den Dorfbewohnern begrüßt: “Ach, das ist ja schön, dass mal wieder ein Pilger hier ist. Der letzte war vor einem Jahr da.” Damit war eindeutig, dass er nicht mehr auf dem offiziellen Pilgerweg war. Wie gesagt, jedem passiert es irgendwann mal, irgendwo verläuft man sich.
Es hilft nichts, ich muss zwei Kilometer zurück. Dort habe ich eine Brücke über die Autobahn gesehen, und dann werde ich doch notgedrungen auf die neue Pilgertrasse wechseln müssen. Für weitere Experimente habe ich heute morgen keine Kraft mehr. Und als ich nach eineinhalb Stunden mühsamen Gehens gerade wieder einen Kilometer von dem Refugio entfernt bin, wo ich letzte Nacht geschlafen habe, ist meine Stimmung ziemlich auf dem Nullpunkt. Ich habe keine Kraft mehr, weder körperlich noch mental. An der ersten Bank entlang der Pilgertrasse mache ich eine Zigarettenpause und frag’ mich leicht verzweifelt, wie um alles in der Welt ich in dem Zustand die dreizehn Kilometer schaffen soll, die vor mir liegen. In dem Moment kommt ein junger Mann den Pilgerweg entlang, bittet mich um eine Zigarette und setzt sich zu mir. Wir beide fangen ein nettes Gespräch miteinander an. Ich sage zu ihm, er sei der erste Pilger, den ich treffe, mit Regenschirm. Er sagte nein, es wäre noch ein zweiter mit Regenschirm unterwegs. Aber ich wäre dafür die erste Pilgerin mit Reiseaschenbecher; denn ich hasse es, Zigarettenkippen auf dem Boden liegen zu lassen. Und nach kurzer Zeit fiel die Entscheidung, wir gehen ein Stück miteinander. Wir entdecken Gemeinsamkeiten, fangen an über das Leben und die Lebendigkeit nachzudenken, und Martin erweist sich als meine Rettung an diesem Tag. Und unsere Gespräche sind wohl für Martin die Rettung, der sich aus einer ziemlich ungeklärten Situation daheim zu einer Denkpause auf den Camino zurückgezogen hat.
Wir tun uns beide gegenseitig gut. Wir werden uns wichtig. In den Gesprächen und Gesten öffnet sich noch Verschlossenes. Wir bleiben drei Tage miteinander auf dem Weg. Und ich bin mir sicher, ohne diese Begegnung wäre mein und sein weiterer Weg nach Santiago anders verlaufen. Als wir uns dort später wieder treffen, staunen wir immer noch, wie sich diese Begegnung gefügt hat, zu seinem und meinem Besten. Einig sind wir uns beide darüber, dass die Software des lieben Gottes die eindeutig bessere ist. Planen kann man solch eine Begegnung nicht, die ist geschenkt. Und ob wir uns begegnet wären, wenn nicht dieser Maschendraht gewesen wäre, weiß ich auch nicht. Es mag sich ein bisschen simpel anhören, aber nach meinen Erfahrungen in diesen Tagen, auf dem Weg nach Santiago werde ich zunehmend sicherer: Manchmal benutzt Gott sogar Maschendrahtzäune, um uns gut zu tun.
7. Szene:
Aufstieg zum Cruz de Ferro. Der Aufstieg fällt uns beiden relativ leicht. Seit Leon ist Christiane dabei, eine Freundin aus Würzburg. Die Sonne scheint – das war nicht immer so, das war einer meiner größten Irrtümer, Nordspanien mit Sonne zu verbinden. Den Sommeranfang hab’ ich erlebt bei 6 Grad plus, bin jeden Morgen los mit Pullover, langärmeliger Bluse, Goretex-Jacke, Sonnenöl war in den ersten zwei Wochen das Überflüssigste, was ich mitgeschleppt habe. Das heißt, es war sehr angenehm zum Wandern, weil man nicht so arg ins Schwitzen kam, wie im Juli oder im August, aber dass es so frisch wäre, hat mich doch persönlich sehr erstaunt. Die kurzen Hosen hätte ich getrost zu Hause lassen können, die hab’ ich wirklich überhaupt nicht gebraucht. Es ist eher so ein Klima wie in Irland, Küstenklima, immer mal wieder Regen, Sonne, schnellwechselnd, Wind, nicht allzu warm.
Am Tag der offenen Himmelstür, Herder 1998
Bunter Faden Zärtlichkeit, Herder 1986
Der gemietete Weihnachtsmann, Herder 1996
Ich bin Lust am Leben, Herder 1997
Ich bin verliebt ins Leben, Herder 1994
Ich mag Gänseblümchen, Herder 1997
Ich schick dir einen Sonnenstrahl, Herder 1997
Ich suche und finde das Leben in mir, Herder 1996
Kater sind eben so, Herder 1991
Der kleine Drache Hab-mich-lieb, Herder 1987
Mich zart berühren lassen von Dir, Herder 1996
Die Sehnsucht ist größer, Herder 1998
Und alles lassen, weil Er mich nicht läßt, Herder 1997
Vom Engel, der immer zu spät kam, Herder 1997
Wenn Chaos Ordnung ist, Herder 1997
Wenn ich meinem Dunkel traue, Herder 1998
Entschieden zur Lebendigkeit,Herder 1999
Die Straße zieht sich leicht den Berg hoch, wunderschöne Ausblicke begleiten uns, und auch den Rucksack bekomme ich nach vier Wochen unterwegssein besser hoch. An dem Tag begleitet mich der Psalm 84: “Wohl den Menschen, die sich zur Wallfahrt rüsten. Ziehen sie durch das trostlose Tal, wird es für sie zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Sie ziehen dahin mit wachsender Kraft.” Ich habe bis dahin diesen Psalm immer mit einer wachsenden körperlichen Kraft assoziiert, und das trifft auch durchaus zu. Ich komme nicht mehr ganz so schnell aus der Puste, wenn es bergauf geht. Aber an dem Tag wird mir klar, dass auch eine seelische, eine innere Kraft in mir wächst. Es ist zum einen die Kraft der Erinnerungen, wenn ich die Pyrenäen gepackt habe, dann werde ich diesen Berg, der vor mir liegt, auch noch packen. Zum zweiten ist es eine Kraft, die aus der Entschiedenheit, der Zielgerichtetheit heraus kommt. Jede Entscheidung an einer Wegkreuzung, den gelben Pfeilen zu folgen, mich damit für eine Richtung zu entscheiden und zugleich gegen drei andere Richtungen, macht mich klarer, eindeutiger und auch identischer. Unentschiedenheit bringt nicht voran. Aber jeder Schritt, der mich entschieden in eine gewisse Richtung bringt, macht mich klarer und macht mich eindeutiger. Von daher kann man den Psalm, glaub’, ich wirklich so übersetzen wie es Erich Zenger tut: “Wohl den Menschen, die Pilgerstraßen in ihrem Herzen tragen. Sie ziehen dahin von Kraft zu Kraft.”
Der Pilgerweg nach Santiago ist ein Weg, der helfen will, bestimmte menschliche Erfahrungen einzuüben. Es ist eine Art Lernfeld. Man kann das auch lernen, ohne nach Santiago gegangen zu sein. Aber wenn man nach Santiago geht, ist es ein bisschen leichter, das zu lernen, weil man das am eigenen Körper erlebt und spürt.
8. Szene
Noch 20,5 Kilometer bis Santiago, so hat es der Kilometerstein heute nachmittag angezeigt. Ich lese die Zahlen auf den Kilometersteinen mit durchaus gemischten Gefühlen. Irgendwie freue ich mich aufs Ankommen und habe zugleich Angst davor. Gut sechs Wochen bin ich jetzt zu Fuß und eine kleine Strecke mit dem Bus unterwegs gewesen, immer nach Westen, den gelben Pfeilen folgend, auf den Weg nach Santiago. Sechs Wochen bin ich mit dem ausgekommen, was ich auf dem Rücken trage. Sechs Wochen lang bin ich morgens irgendwo aufgebrochen, bin den Tag lang in Sonne und Regen in Wind und Weite gewandert, durch endlose Getreidefelder, über Bergpässe, an langweiligen Straßen entlang, durch kleine Dörfer und Städte, auf abenteuerlichen Schlammpfaden. Fünfhundert Kilometer zu Fuß liegen hinter mir, und morgen werde ich nun also in Santiago ankommen. Ich habe durchaus gemischte Gefühle. Mit dem Ankommen geht unwiderruflich etwas zu Ende, was so nicht wiederholbar ist. Selbst wenn ich den Camino noch mal gehen können, wird es dann anders sein. Und da ist ein bisschen Traurigkeit in mir, als mir das so bewusst wird, und gleichzeitig freue ich mich. Ich freue mich auf Santiago, auf zu Hause und darauf, mal wieder endlich einen anderen Pullover anziehen zu können, als nur den einen, den ich dabei habe. Ich freue mich d’rauf, mal wieder ganz alleine zu schlafen und nicht in einem riesengroßen Schlafsaal. Ich träume davon, mir in Santiago ein weiches, weißes, ganz sauberes und neues Sweatshirt zu kaufen. Am Monte del Gozo, den Berg, von dem man aus das erste Mal auf Santiago sieht, will sich bei mir die rechte Freude noch nicht so ganz einstellen, schließlich die Kathedrale. Und mit Christiane sitz ich eine halbe Stunde davor, und wir wollen beide noch nicht so richtig hinein. Schließlich entbieten wir unseren Ankommensgruß, wie es Millionen von Pilgern vor uns getan haben. Und ich lege die Hand in die Säule, die sich mir fast entgegen schmiegt. Dann gehen wir wieder. Noch ist Besichtigung nicht angesagt.
An diesem Tag laufe ich fast wie ein bisschen geistig verwirrt durch diese wunderschöne Stadt. Ich bin da und bin doch nicht da. Und erst am nächsten Tag löst sich die Spannung bei der Pilgermesse. Es ist das Fest “Maria Heimsuchung”, der Besuch Marias bei Elisabeth. Und zu Ehren dieses Festes wird das Rauchfass geschwungen. Und in dem Moment hält es mich nicht mehr auf der Kirchenbank, ich muss aufstehen und mir kommen die Tränen. Mir fällt das Lied ein, das ich so gern’ singe: In deinen Toren werd ich stehen, du freie Stadt Jerusalem, in deinen Toren kann ich atmen, erklingt mein Lied. Jetzt und hier erahne ich etwas davon, was das bedeuten kann. Frieden zieht in mir ein, Gelassenheit, eine neue Gewissheit, was wirklich wichtig ist, und eine tiefe Freude. Und mir wird zunehmend klar: Nein, der Weg ist nicht das Ziel. Der Weg ist wichtig, aber er braucht das Ziel. Der Weg ist nicht schon in sich wertvoll, der Weg braucht das Ziel, damit ich ankommen kann, so schwer es manchmal auch sein mag. Ohne Ziel wird der Wanderer zum Vagabunden und zum Abenteurer, denn dann wird es beliebig, wohin er geht. Der Camino, der Weg von Santiago de Compostela, hat sein Ziel und kann damit zu einem Abbild von Lebensweg und Lebensziel werden.
An diesem Abend verabschieden wir Doris und David, ein älteres englisches Ehepaar, das wir oft auf dem Weg getroffen haben. Morgen werden sie nach Hause zurückfahren, und sie wissen nicht, ob sie in ihrem Leben noch einmal Santiago sehen werden. Auf dem jetzt menschenleeren Platz vor der Kathedrale, im warmen Abendlicht, setzt sich David im Schneidersitz vor die Kathedrale und nimmt leise für sich Abschied. Vom kleinen Platz in der Nähe tönt leise Saxophonmusik eines Straßenmusikanten: “Should auld acquaintance be forgot” – Nehmt Abschied, Brüder, ungewiss ist alle Wiederkehr. Jedes Ankommen bedeutet neues Aufbrechen. Trotz Pullover bekomme ich ein bisschen Gänsehaut in diesem Moment, ich muss schlucken und ahne darum, dass möglicherweise mit der Ankunft in Santiago der Weg überhaupt erst beginnt.
9. Szene
Hinter mir liegt eine lange Zugfahrt, und ich bin ein bisschen übernächtigt. Es war ein seltsames Gefühl, mit dem Zug durch die nordspanische Landschaft zu fahren, die ich sechs Wochen lang durchwandert habe. In der Meseta haben wir einige Pilger gesehen. Ich hab’ die Autobahnbrücke entdeckt, bei der ich Martin getroffen habe, im Reiseführer habe ich die Etappen noch mal nachgelesen. Es ist unwirklich, wieder in Deutschland zu sein, es ist unwirklich, nach sechs Wochen Pilgern wieder in den Alltag zu kommen.
Maria, die Amerikanerin, die mit uns bis Straßburg zurückfährt, fragt uns ein bisschen ratlos, nachdem sie ein Vierteljahr unterwegs war: “Wie macht man das, nicht mehr zu pilgern? Was macht man eigentlich, wenn man morgens nicht mehr aufbricht, den Rucksack packt, irgendwo losgeht, Quartier sucht, sich was zu Essen organisiert, was macht man dann?”
Als mich Manfred am Bahnhof in Worms abholt, wir mit dem Auto durch die Stadt fahren, bin ich richtig erschrocken: “Das ist aber schnell!” Manfred schaut mich überrascht an und sagt: “Ich fahr’ grad 30!” Und als er mich verabschiedet, sagt er: “Denke bitte dran, in Deutschland gibt es eine Mindestgeschwindigkeit auf Autobahnen.” Ich hab’ mich, glaub’ ich, nie so deutlich an Geschwindigkeitsbegrenzungen gehalten wie die ersten sechs Tage, nachdem ich vom Camino zurück war.
Am Abend sitz’ ich in meiner Wohnung, und mir ist schon wieder nach Weinen zumute. Die Freunde haben sich in meiner Abwesenheit zu liebevoll um die Wohnung gekümmert und mich hier so liebevoll empfangen. Aber die Wohnung scheint mir viel zu groß zu sein und ein Schlafzimmer ganz für mich alleine? Fast weiß ich schon nicht mehr, was das ist! Und als ich vor meinem Kleiderschrank stehe, erschrecke ich. Soviel Klamotten? Wie soll ich mich da nur entscheiden, was ich anziehen soll? Sechs Wochen lang war das einzige Kriterium, was ist das Kleidungsstück, was am wenigsten dreckig ist. Ich blättere im Tagebuch herum. Auf dem CD-Player liegt eine der CD’s mit der galizischen Musik, die ich mir mitgebracht habe und die letzten Tage in Santiago oft gehört habe. Ich bin gespannt auf die Dias und freue mich auf den Gottesdienst morgen früh. Von dort bin ich von der Gemeinde losgeschickt worden mit dem Pilgersegen. Nach dem Gottesdienst werde ich die Muschel abnehmen, die ich sechseinhalb Wochen getragen habe. In mir ist viel Dankbarkeit für das Erlebte, und einen Moment lang denke ich: Nach dem Weg und dem Ankommen in Santiago fällt mir das Wiederheimkommen schwer. Ich bin grad froh bei dem Gedanken, dass, wenn ich eines Tages bei meinem himmlischen Vater angekommen bin, nicht wieder zurück muss in irgendeinen Alltag. Ich darf dann wirklich dort bleiben, wohin ich hingepilgert bin.
Was heißt Pilgern jetzt für mich? Mich festmachen in Gott und auf Grund dessen in Bewegung kommen, von Gott ausgehen, zugleich auf Gott zugehen, bei den Menschen sein. Und wenn ich auf mich schaue, stelle ich erstaunt fest, es hat sich was geändert: Ich bin weicher und stärker geworden, empfindsamer und toleranter, gelassener und geduldiger, Gott vertrauender und mit einem Blick für das wirklich Wichtige.
Letzte Szene
Ende Oktober. Ein bisschen traurig drücke ich die Taste “Speichern” am Computer. Die letzte Datei des Pilgertagebuches ist eingegeben. Schade! Dieses Tagebuch hat in den letzten Wochen und Monaten den Weg sehr lebendig gehalten. Neu, ganz neu habe ich mich in diesen Wochen in die Landschaft Rheinhessens verliebt, hab’ mich hinausziehen lassen in die Weite und Unendlichkeit auch dieser Landschaft, durchschnitten von kleinen Tälern, in denen die Dörfer versteckt liegen. Ich bin lebendiger geworden durch die Erfahrungen auf dem Camino. Lebendigkeit hat etwas mit Haltungen und Einstellungen zu tun, mit einem Wechsel der Perspektive, dem Mut loszulassen und den Aufbruch zu wagen. Dafür kann der Camino ein Lernfeld sein. Wenn ich mich wirklich auf diesen Weg einlasse, und wenn ich dem Weg nicht vorschreibe, was er mir zu geben hat, wie er zu sein hat, wenn ich wirklich offen bin für das ganz andere. Die christliche Zusage steht: Sucht und ihr werdet finden. Dummerweise wird nicht dazu gesagt, ob das, was wir finden werden, auch das ist, was wir gesucht hatten. Menschen, die von vornherein dem Camino vorschreiben, was sie dort erfahren möchten, werden ihre Geschenke möglicherweise nicht bekommen. Zum Camino gehört auch das Loslassen. In volle Hände kann Gott nichts mehr hineinlegen. Ich persönlich habe Ehrfurcht vor diesem Weg bekommen. Es ist ein spiritueller Weg. Natürlich kann man diesen Weg aus sportlichen oder kunsthistorischen Interessen gehen, aber man wird die Erfahrungen nicht machen können, die dieser Weg in sich birgt. Es ist ein Weg, der Geschichte hat, und der die Kraft von Hunderttausenden von Pilgern, die diesen Weg über Jahrhunderte hinweg gegangen sind, aufgenommen hat, und an die Pilger, die sich heute auf diesen Weg machen, auch wieder abgibt, wenn sie bereit dazu sind. Verräterisch mag die Sprache sein, wenn jemand sagt: “Ich mach den Weg.” Der Weg lässt sich nicht machen, dieser Weg ist immer Geschenk. Ich mach den Weg, das hört sich an wie: ich mach den Berg, ich mach dich klein, ich schaff dich, um mich zu bestätigen. Wer den Camino so angeht, um eine bestimmte Strecke zu Fuß zurückzulegen, der mag von dem, was dort möglich ist, nichts erleben. Der Camino und das Leben sind geschenkt und sind nicht machbar, und sie wollen unser Staunen, unsere Offenheit, unsere Liebe und die Bereitschaft zum Aufbruch. Und wer meint, dass sich seine Sehnsucht mit der Ankunft in Santiago stillen lässt, auch der wird sich täuschen. Die Sehnsucht ist größer, und auch der Weg nach Santiago de Compostela ist nur ein Abbild menschlichen Weges. Unsere eigentliche Sehnsucht zielt auf etwas Anderes. Santiago ist nur Abbild dafür, aber das kann möglicherweise ganz schön viel sein, weil man auf dem Weg nach Santiago diese Erfahrung machen kann, die man auch im Leben machen kann. Ja, es war ein Weg, es waren sechs Wochen, die Mühe gemacht haben, die anstrengend waren, die nicht immer leicht waren. Es waren sechs Wochen in meinem Leben, die ich nicht missen möchte, die ich nicht hergeben möchte. Es waren sechs Wochen, in denen ich unsagbar reich beschenkt worden bin. Sechs Wochen, in denen ich mich verändert habe, sechs Wochen, an denen ich gewachsen bin. Und ich glaube, der Weg hat tatsächlich was mit Christsein zu tun, denn auch die Bibel erzählt davon. Immer dort, wo sich Menschen von Gott berühren lassen, brechen sie auf und gehen sie los, nehmen ein Stück Weg unter die Füße. Maria, die zu Elisabeth geht, die Jünger, die ihre Familien verlassen, aufbrechen und losgehen und Jesus selbst, der als Wanderprediger umherzog. Er bildete seine Nachfolger nicht an einer theologischen Hochschule aus, sondern im Unterwegssein und in der Begegnung mit dem Menschen. Das kann man auf dem Camino erleben, aber genauso spannend ist es, das im Emsland zu erleben. Man kann diese Erfahrungen auf dem Weg nach Santiago machen, aber gefragt ist eigentlich auch, wenn ich solche Erfahrungen mache, die dann auch im Emsland, zwischen Lingen und Haselünne und Handrup, entsprechend zu leben.
Ich wünsche Ihnen viel Mut zum Aufbruch, Zeit zu einem inneren Aufbruch, seien es die Pilgerwege in Ihrem Herzen, vielleicht für den einen und die andere auch ein äußerer Aufbruch, ein sich leibhaftig auf den Weg machen. Möge Gott, der treue Wegbegleiter, Sie auf diesem Weg einfach begleiten. Ich sag’ danke für’ s Zuhören im ersten Teil, jetzt kommen noch 150 Dias, wird jetzt ein bisschen lockerer, nicht mehr ganz so meditativ schwer, ich möchte einfach noch so ein paar Eindrücke vermitteln, wie sieht’ s denn da jetzt aus, nachdem Sie jetzt wissen, was man da so erleben kann.